Die Vielfalt an Sprachen öffnet Tür und Tor zu unterschiedlichen Kulturen. Doch eine besondere Schlüsselrolle spielt Plattdeutsch, eine regionale Sprache, die nicht nur Türen, sondern auch Herzen öffnet. In diesem Artikel tauchen wir ein in die Welt des Plattdeutschen und geben wertvolle Tipps für all jene, die sich dieser faszinierenden Regionalsprache widmen möchten.
Zunächst einmal kann man nur gratulieren an all jene, die Plattdeutsch lernen möchten. Mehrsprachigkeit öffnet einem nicht nur viele Türen, sondern wirkt sich auch positiv auf die kognitiven und sozialen Fähigkeiten eines Menschen aus. Das gilt auch für das Plattdeutsche. Durch das Erlernen der Regionalsprache können zusätzlich die regionale Identität und das Heimatbewusstsein verstärkt werden.
Plattdeutsch lernen für Anfänger
Als Hilfestellung haben wir ein paar Tipps zum Plattdeutsch lernen zusammengetragen, wie zum Beispiel plattdeutsche Lehrmaterialien:
- „Plattdüütsch – Das echte Norddeutsch: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How“ (Hermann Fründt, Hans-Jürgen Fründt; ISBN: 978-3831765638)
- „Sprachführer Plattdüütsch: Ein Lehr- und Lernbuch“ (Hartmut Cyriacks, Peter Nissen; ISBN:978-3876512044)
- „Hör- und Lernbuch für das Plattdeutsche“ (Renate Hermann-Winter; ISBN: 978-3-35602-115-8)*
- „Snacken, Proten, Kören: Plattdüütsch-Lehrbook för de SEK I“ (Länderzentrum für Niederdeutsch (Hrsg.); ISBN: 978-3876514772)
- „Platt – dat Lehrbook“ (Hartmut Arbatzat; ISBN: 978-3-87651-431-4)
- „Fiete lehrt Plattdüütsch“ (Rolf Schwippert; ISBN: 978-3-89876-227-4)
- „Platt mit Plietschmanns“ (Wolfgang Hohmann; ISBN: 978-3-35602-201-8)*
[*vorrangig für Mecklenburg-Vorpommern]
„Plattdüütsch mit Lütt-Mariken | Ünnerwägens in de Stadt„
Im lang ersehnten zweiten Teil von „Lütt-Mariken“ nimmt sie euch mit auf einen kleinen Stadtbummel – natürlich wieder auf Plattdeutsch!
„Plattdüütsch mit Lütt-Mariken“ | buch für Jung und Alt
Das Kinderbuch “Plattdüütsch mit Lütt-Mariken” (3. Auflage) nimmt euch mit auf eine kleine bunte Reise und vermittelt spielerisch erste Wörter, Sprüche und Lieder in plattdeutscher Sprache.
Für mich ist Plattdeutsch die schönste Sprache der Welt. Höre ich jemanden Plattdeutsch sprechen, fühle ich mich Zuhause. Die Sprache ist ein Teil meiner Heimat. Man kann auf Platt schimpfen, lachen, aber auch ernste Themen ansprechen. Platt kommt immer von Herzen und ist ehrlich. Ihr wollt Plattdeutsch lernen? Ich helfe euch gerne dabei.
Lütt-Mariken
Plattdeutsches Wort des Jahres
Plattdeutsche Wort des Jahres, aktueller Ausdruck und liebste Redensart im Jahresverlauf sowie aktuelle Infos findest Du hier.
Read MorePlattdeutsche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern – Kultur erleben up Platt
Entdecke plattdeutsche Veranstaltungen: Theater, Lesungen & Konzerte op Platt. Erlebe regionale Kultur von plattdeutsches Theater bis zu Traditi…
Read MorePlattdeutsche Sprache: Voller Charakter und Charme
Tauche ein in die faszinierende Welt der plattdeutschen Sprache, auch bekannt als Niederdeutsch! Entdecke eine Vielzahl von spannenden Themen.
Read MoreWer auf Lehrbücher verzichten möchte, dem helfen vielleicht diese Anregungen weiter:
- Spaß haben: Lerne Plattdeutsch mit Freude und Begeisterung. Finde heraus, was dich motiviert und interessiert, und integriere diese Aspekte in dein Lernprogramm.
- Finde Ressourcen: Suche nach Büchern, Online-Kursen, Audioprogrammen oder Plattdeutsch-Sprachpartnern. Es gibt möglicherweise lokale Plattdeutschgruppen oder -vereine in deiner Region, die dir helfen können. (Atlas Niederdeutsch)
- Hör Plattdeutsch: Um ein Gefühl für die Aussprache und den Klang der Sprache zu bekommen, ist es wichtig, Plattdeutsch zu hören. Dabei helfen dir Hörbücher, Podcasts oder Radiosendungen up Platt.
- Schau Plattdeutsch: Sieh dir plattdeutsche Filme, Serien, YouTube-Videos, Dokumentationen oder Fernsehbeiträge an.
- Lies Plattdeutsch: Nimm plattdeutsche (Kinder)Bücher, Zeitungsartikel, Kolumnen, Gedichte oder Internetseiten (wie das plattdeutsche Wikipedia) zu Hilfe, um Plattdeutsch lesen zu üben.
- Sprachpraxis: Übe regelmäßig, Plattdeutsch zu sprechen. Suche nach Möglichkeiten, mit Plattsprechern in Kontakt zu treten, sei es online oder persönlich. Je mehr du sprichst, desto besser wirst du darin.
- Baue deinen Wortschatz auf: Sammle eine Liste von plattdeutschen Wörtern und lerne sie systematisch. Achte darauf, wie sie ausgesprochen werden und wie sie in Sätzen verwendet werden.
- Schreiben üben: Versuche, in Plattdeutsch zu schreiben, um deine Schreibfertigkeiten zu verbessern. Du kannst zum Beispiel Tagebücher, Geschichten oder Briefe auf Plattdeutsch verfassen.
- Immer dranbleiben: Das Erlernen einer neuen Sprache erfordert Zeit und Engagement. Setze dir realistische Ziele und bleibe diszipliniert. Übe regelmäßig, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
- Kulturelles Verständnis: Tauche in die plattdeutsche Kultur ein, indem du Bücher, Filme und Lieder auf Plattdeutsch erkundest. Dies wird dir helfen, ein tieferes Verständnis für die Sprache und ihre kulturelle Bedeutung zu entwickeln.
- Fehler machen ist in Ordnung: Sei nicht entmutigt, wenn du Fehler machst. Das gehört zum Lernprozess dazu. Nutze deine Fehler als Lerngelegenheiten und verbessere dich kontinuierlich.
Denke daran, dass das Lernen einer neuen Sprache Zeit und Geduld erfordert. Mit regelmäßiger Praxis und Hingabe wirst du Fortschritte machen und deine Plattdeutschkenntnisse verbessern.
Die TOP 6 der Plattdeutsch-FAQs!
Mit diesen sechs ultimativen Plattdeutsch-FAQs wirst du zum echten Kenner und begeisterst bei jedem plattdeutschen Gespräch!
Wie sagt man auf Plattdeutsch „Hallo“?
Zur Begrüßung hört man im Plattdeutschen häufig die Wendungen „Moin„, „Dach ok„, „Taching“ und „Gauden Dach„.
Wie sagt man auf Plattdeutsch „Danke“?
Auf Plattdeutsch sagt man “Danke” normalerweise mit “Dank di”, “Välen Dank!” oder “Ik dank von Harten”.
Wie sagt man „Tschüß“ auf Platt?
Um sich up Platt zu verabschieden, kann man z.B. sagen „Adschüß„, „Tschüßing„, „Up bald!“ (Bis bald!) und „Mak dat (gaut)!“ (Mach’s gut!).
Was heißt „Ich liebe dich“ auf Platt?
Up Platt gesteht man jemandem seine Liebe mit den Worten „Ik heff di leif„.
Was heißt „Wie geht es dir?“ auf Plattdeutsch?
Wenn man sich up Platt nach dem Befinden seines Gegenübers erkundigt, fragt man „Wie geiht di dat?“ oder „Wo(ans) geiht di dat?„.
Was heißt auf Plattdeutsch „Gute Nacht“?
Als Gute-Nacht-Gruß sagt man up Platt ganz einfach „Gaude Nacht!“ und „Schlap gaut!“ (Schlaf gut!)
Teste jetzt Dein Plattdeutsch-Wissen!
Beantworte die acht Fragen und teste, wie gut du dich bereits im Plattdeutschen auskennst. Am Ende des Quiz erhältst du die Auflösung und für alle falschen Antworten eine kurze Erläuterung. Alle Wörter kannst du hier übersetzen. Teile dein Ergebnis mit deinen Freunden auf Facebook und Twitter.
#1. Was macht man mit „Schlackermaschü“?
Schlackermaschü wird auf Plattdeutsch Schlagsahne, Pudding genannt.
#2. Was ist ein „Plüschnors“?
Die Hummel wird im Plattdeutschen als „Plüschnors“ (auch Plüschmors, Plüschnoors) bezeichnet.
#3. „Brummelbeer“, „Bickbeer“ un „Stickelbeer“ sind…
„Bummelbeer“ ist die Brombeere, „Bickbeer“ die Blaubeere und „Stickelbeer“ die Stachelbeere.
#4. Was ist ein „Klappräkner“?
Der „Klappräkner“ ist die plattdeutsche Bezeichnung für einen Laptop, einen „Klapprechner“.
#5. In wie vielen deutschen Bundesländern wird offiziell Plattdeutsch gesprochen?
Plattdeutsch spricht man in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in Teilen Brandenburgs, Sachsen-Anhalts und Nordrhein-Westfalens.
#6. Wer oder was ist „Mammelutsch“?
„Mammelutsch“ oder „Marmelad“ ist die Marmelade.
#7. Was ist „Mangkaktäten“?
Zum Eintopf sagt man im Plattdeutschen „Mangkaktäten“ (vermengt gekochtes Essen).
#8. Was ist ein „Iesenbahnbomupundaldreiger“?
Der „Iesen-bahn-bom-up-un-dal-dreiger“ ist der Schrankenwärter. Er „dreht den Eisenbahnbaum (Schranke) hoch und runter“.
Ergebnisse

Toll, Du bist auf dem besten Wege Plattdeutsch zu lernen.
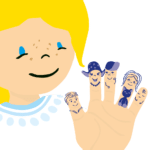
Schlüsselanhänger „Plattschnacker“ oder „Ik schnack Platt“
Erhältlich: Zwei Varianten – „Plattschnacker“ oder „Ik schnack Platt“ Material: Buchenholz mit langlebiger Gravur Design: Edler Kunstl…
Read MorePlattdeutsche Schätze: Kinderbuch & Postkarten im Premium-Set!
Im "Postkarten-Paket" enthalten: 1x Bilderbuch „Plattdüütsch mit Lütt-Mariken“ | 3.Auflage 3 hochwertige plattdeutsche Postkarten …
Read MoreMaritime Plattdeutsch-Postkarten: Perfekt als Geschenk oder Deko
drei hochwertige plattdeutsche Postkarten mit Soft-Feel-Veredelung Motiv 1: "Klaukschieter” mit Möwen Motiv 2: "Nützt je nix!" mit Seg…
Read MorePlattdeutsche Postkarte | Motiv: „Klaukschieter“ mit Möwen
Motiv: "Klaukschieter" mit Möwen Format: DIN A6 | 14,8 x 10,5 cm Papierqualität: 300 g/qm Premiumpapier mit Soft-Feel-Veredelung Be…
Read MoreWeitere Tipps zum Plattdeutsch lernen
Für unbekannte bzw. unverständliche Wörter ein Wörterbuch zu Hilfe nehmen:
- Lütt-Marikens Online-Wörterbuch (vorrangig für Mecklenburg-Vorpommern)
- Plattdeutsches Wörterbuch für Mecklenburg-Vorpommern (nach Prof. Dr. Renate Herrmann-Winter)
- Plattdeutsches Netzwörterbuch (vorrangig für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg)
- Teil der plattdeutschen Community auf Instagram werden. #platterfreitag
Wer ständig von der Sprache umgeben ist und diese regelmäßig anwendet, wird schnell erste Lernerfolge vorweisen können.
Mit Apps zum Lernerfolg
Neben Online-Wörterbüchern gibt es mittlerweile auch noch andere digitale Hilfsmittel wie z.B. Apps, die das Palttdeutschlernen unterstützen und vereinfachen. So wie „PlattinO – Die Plattlern-App„, mit der das ostfriesische Plattdeutsch vermittelt wird.
Die Plattdeutsch-Lern-App ermöglicht eine strukturierte Annäherung an das ostfriesische Plattdeutsch über verschiedene Themenbereiche und Schwierigkeitsgrade. Durch diverse Übungen für Hörverständnis, Aussprache, Grammatik und Rechtschreibung werden praxisnahe Lerninhalte vermittelt, darunter wichtige Vokabeln und im Alltag relevante kurze Sätze. Die Lektionen sind abwechslungsreich gestaltet und verwenden sechs verschiedene Aufgabenvarianten, authentische Audiodateien eines Muttersprachlers (Rheiderländer Platt) sowie eigens erstellte Grafiken. Dieser Ansatz bietet eine effektive und ansprechende Möglichkeit, das ostfriesische Plattdeutsch zu erlernen.
Die App kann kostenlos im Google Play und auch im Apple Store heruntergeladen werden.

Nach dem Philosophen Voltaire heißt es: „Kennst du viele Sprachen – hast du viele Schlüssel für ein Schloss.„
Herausforderungen beim Plattdeutsch lernen
Das Erlernen des Plattdeutschen bringt einige besondere Herausforderungen mit sich, insbesondere aufgrund der regional unterschiedlichen Aussprache und Schreibweise. Obwohl Plattdeutsch eine einheitliche Regionalsprache ist, variieren die Dialekte und Ausdrucksformen von Region zu Region sehr stark, was es für die Lernenden schwierig machen kann, eine einheitliche Version der Sprache zu erlernen. Ein und dasselbe plattdeutsche Wort kann in einem Nachbarort anders ausgesprochen oder geschrieben werden, was das Verständnis erschwert und zusätzliche Anstrengungen erfordert, um sich an die lokalen Variationen anzupassen.
Diese Vielfalt ist jedoch auch ein reizvoller Aspekt des Plattdeutschen und ermöglicht es den Lernenden, eine tiefere kulturelle Verbindung zu den verschiedenen Regionen aufzubauen, während sie ihre Sprachkenntnisse vertiefen.
Mit Kindern Plattdeutsch lernen
Das Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt keine Altersbeschränkung, um eine neue Sprache zu lernen. Auch im fortgeschrittenen Alter kann sich ein Mensch neue Dinge aneignen. Dennoch lernt es sich im Kindesalter am einfachsten, da das Gehirn zu dieser Zeit am leistungsfähigsten ist. Kinder nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Sie sind unglaublich aufnahmefähig und wissbegierig. Diese Fähigkeiten kann man sich auch für das Plattdeutschlernen zunutze machen.
Denn eine frühe Mehrsprachigkeit bietet viele Vorteile. Sie wirkt sich positiv auf die kognitiven und sozialen Fähigkeiten eines Kindes aus, erleichtert ihm das Erlernen weiterer Fremdsprachen und fördert die regionale Identität. Aus diesem Grund hat Lütt-Mariken ein Bilderbuch veröffentlicht und sich weitere Materialien überlegt, mit denen man Kindern spielerisch die plattdeutsche Sprache näher bringen kann.
Tauche ein in die faszinierende Welt des Plattdeutschen und lass dich sich von seiner Vielfalt und Schönheit inspirieren. Mit den richtigen Ressourcen und einer Prise Neugierde steht dir die Tür offen, diese einzigartige Sprache zu entdecken und zu meistern. Väl Spaß bi’t Plattdütschlihrn!“
Plattdeutsch lernen mit Lütt-Mariken – Eure Fragen, unsere Antworten
Was ist Plattdeutsch eigentlich?
Plattdeutsch – auch Niederdeutsch genannt – ist eine eigenständige Sprache mit jahrhundertealter Tradition. In vielen Regionen Norddeutschlands, darunter auch Mecklenburg-Vorpommern, wird sie bis heute gesprochen und gepflegt. Sie unterscheidet sich deutlich vom Hochdeutschen, hat aber viele interessante sprachliche Parallelen.
Für wen eignet sich ein Plattdeutsch-Kurs?
Plattdeutsch lernen können alle – ob Jung oder Alt, Einsteiger oder Fortgeschrittene. Besonders für Familien, die ihre Kinder spielerisch an die Regionalsprache heranführen möchten, ist es ein tolles gemeinsames Erlebnis. Auch für Zugezogene oder Urlaubsgäste ist es eine schöne Möglichkeit, Kultur und Sprache Mecklenburg-Vorpommerns kennenzulernen.
Wie schwer ist es, Plattdeutsch zu lernen?
Das kommt ganz auf Deinen sprachlichen Hintergrund an. Wer Hochdeutsch spricht, hat oft schon ein gutes Gespür für die plattdeutsche Grammatik und den Wortschatz. Vieles klingt vertraut – manches ganz anders. Aber keine Sorge: Mit Spaß und regelmäßigem Üben klappt der Einstieg schnell.
Gibt es Online-Angebote zum Plattdeutsch lernen?
Ja! Es gibt viele moderne Lernformate – von YouTube-Videos über Podcasts bis hin zu Online-Kursen. Auf unserer Seite stellen wir Euch einige kostenlose und kostenpflichtige Angebote vor, mit denen Ihr direkt loslegen könnt – egal, ob Ihr zuhause oder unterwegs seid.
Wo kann man in Mecklenburg-Vorpommern Plattdeutsch lernen?
In vielen Regionen MV gibt es lokale Kurse, Volkshochschulen, Heimatvereine oder kulturelle Einrichtungen, die regelmäßig Angebote zum Plattdeutsch lernen machen. Auch Kitas und Schulen greifen das Thema zunehmend auf. Einige Veranstaltungen werden sogar auf Plattdeutsch moderiert – perfekt zum Eintauchen!
Gibt es Angebote für Kinder?
Unbedingt! Plattdeutsch lernen mit Geschichten, Liedern, Spielen oder kleinen Theaterstücken – das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch das kulturelle Verständnis. Viele Programme sind speziell auf Kinder und Familien zugeschnitten.
Warum sollte ich Plattdeutsch überhaupt lernen?
Weil Du damit ein lebendiges Stück norddeutscher Identität bewahrst – und gleichzeitig eine Tür zur Kultur, Geschichte und Lebensart Mecklenburg-Vorpommerns öffnest. Es fördert das Miteinander, schafft Verbindungen zwischen Generationen und ist einfach etwas ganz Besonderes.
Kann man mit Lütt-Mariken auch in der Kita oder Grundschule arbeiten?
Ja! Viele Materialien von Lütt-Marikensind auch für den Einsatz in Bildungseinrichtungen konzipiert – z. B. als Teil von Projekttagen oder regelmäßigem Sprachunterricht.















Hallo Ilka,
Niederdeutsch hat ganz klar eigene Laute, die das Deutsche nicht hat. Ich frage mich deshalb warum sie das schreiben? Und auch ihre Annahme das „å“ käme schriftlich nicht im Niederdeutschen vor ist schlichtweg falsch. Ob im frühesten Plattdeutsch im Mittelalter, bei Groth und anderen großen Dichtern kam das „å“, das „æ“ und auch das“œ“ vor. In Mecklenburg sogar das schon im Eigennamen stehende „ę“. Sprechen sie überhaupt selbst Niederdeutsch? Wie meine Vorrednerin richtig beschrieben hat, haben unterschiedlichen Varianten im Plattdeutschen manchmal eine unterschiedliche Aussprache. Das Å ist ein Ton zwischen a und o, welchen es im Deutschen einfach nicht gibt. Es wird genau wie das dänische Å manchmal mit ‚AA‘ geschrieben, was aber umständlich ist. Es ist sehr gut und schön das MV jetzt eine einheitliche Rechtschreibung für Plattdeutsch hat und das Å ist da genau richtig aufgehoben, da es auch sprachlich einfach die Verwandtschaft zu Nordeuropa zeigt. Im Westen von Norddeutschland wird dagegen statt dem praktischen Å, entweder a, o, aa oder oo geschrieben. Jüst’n Kuddelmuddel. Also Lütt Mariken. Jüst so as du dat seggt hest, måkt wieder so bi jüm Rechtschrieven. Weest bedankt för de Siet.
Sihr verihrte Fruu Bojara,
se hemm` een schönen Internetuptritt. Dor koenen sick anner Lüüd` `ne Schiew von
afschnieden. De Striederie, wecker dat richtige „Platt“ schrifft orrer spräkt, möt jo woll
in`t eenuntwindigsten Johrhunnert uphüren. In een Dörp seggen se to`n Bispill :
„Holl di wiß“ in dat anner „Holl di fast“. De Maekelborger orrer Vöpommer de `n bäten
plietsch in sien Brägen is, ward woll beides verstahn! Maken`S man wieder so!
Uwe Schmidt, Niegenbramborg
Ich freue mich sehr über diese Seite.
Welchen Grund gibt es, entgegen all unseren plattdeutschen Dichtern und Denkern, plötzlich ein skandinavisches „Boller-Ooooh“ (Å) zu benutzen? Im Schwedischen is es das lange „o“ aus dem Deutschen. Wasinallerwelt hat es bei uns im Plattdeutschen zu suchen? „Tausammen“ ist nicht plötzlich „tausåmen“ („tausohmen“…???) – so spricht doch keiner!
Soll es optisch schick sein und das Plattdeutsche dadurch aufwerten?
Ich finde es komplett unangepasst. Es gibt in unserer Sprache alle Zeichen, die wir benötigen, um Plattdeutsches aufzuschreiben.
Ich bin gespannt auf Ihre Erklärung und würde mich auch über eine Information freuen, die mir sagt, seit wann dieser Buchstabe benutzt werden „soll“ und wie Sie darauf kommen, ihn zu verwenden. Welche Sprache in aller Welt nehmen Sie dafür als Grundlage? Das Schwedische kann es ja wohl schlecht sein…
Ich ärgere mich darüber, dass plötzlich eine Vermischung mit skandinavischen Sprachen erfolgt. Das geht einfach nicht.
Guten Morgen Frau Wilczek,
vielen Dank für Ihren Kommentar.
Im Plattdeutschen gibt es wirklich eine Vielzahl an Varianten was Aussprache und Schreibweise angeht.
Seit 2016 kann in Mecklenburg-Vorpommern an einigen Schulen das Abitur auf Plattdeutsch abgelegt werden. So musste also eine einheitliche Rechtschreibung her.
Es wurde sich auf die Nutzung der plattdeutsch-hochdeutschen Wörterbücher von Renate Hermann-Winter geeinigt. Darin findet auch das Boller-A Verwendung.
Lütt-Mariken hat sich auch an diese Schreibweise angepasst. In ihrem Online-Wörterbuch (www.luett-mariken.de/plattdeutsch-uebersetzen) werden aber stets mehrere Schreibweisen aufgeführt.
Allen Plattschnackern gerecht zu werden, ist leider gar nicht so einfach oder sogar unmöglich.
Viele Grüße,
Lütt-Mariken
Hallo Ilka,
Niederdeutsch hat ganz klar eigene Laute, die das Deutsche nicht hat. Ich frage mich deshalb warum sie das schreiben? Und auch ihre Annahme das „å“ käme schriftlich nicht im Niederdeutschen vor ist schlichtweg falsch. Ob im frühesten Plattdeutsch im Mittelalter, bei Groth und anderen großen Dichtern kam das „å“, das „æ“ und auch das“œ“ vor. In Mecklenburg sogar das schon im Eigennamen stehende „ę“. Sprechen sie überhaupt selbst Niederdeutsch? Wie meine Vorrednerin richtig beschrieben hat, haben unterschiedlichen Varianten im Plattdeutschen manchmal eine unterschiedliche Aussprache. Das Å ist ein Ton zwischen a und o, welchen es im Deutschen einfach nicht gibt. Es wird genau wie das dänische Å manchmal mit ‚AA‘ geschrieben, was aber umständlich ist. Es ist sehr gut und schön das MV jetzt eine einheitliche Rechtschreibung für Plattdeutsch hat und das Å ist da genau richtig aufgehoben, da es auch sprachlich einfach die Verwandtschaft zu Nordeuropa zeigt. Im Westen von Norddeutschland wird dagegen statt dem praktischen Å, entweder a, o, aa oder oo geschrieben. Jüst’n Kuddelmuddel. Also Lütt Mariken. Jüst so as du dat seggt hest, måkt wieder so bi jüm Rechtschrieven. Weest bedankt för de Siet.